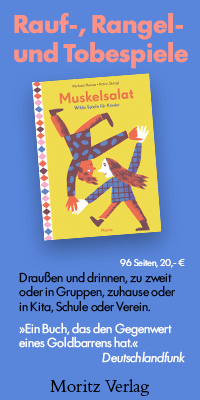|
Wie die Stadt Monheim sozial Benachteiligte früher fördert
Wie nehmen Kommunen Kinder mit ihren Rechten und Bedürfnissen besser wahr? Wie richten sie ihre Politiken daran aus? Welche Folgen hat das für die Jüngsten?
Wie kann gelingende Kinderpolitik aussehen? Und welche Wege führen dorthin? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer neuen Betrifft KINDER-Serie. Unsere zweite Station ist Monheim. Ein Beitrag von Barbara Leitner.
Die Stadt Monheim agiert unter Bedingungen wie die meisten Kommunen in unserem Land. Der Haushalt weist ein zwar geringer werdendes, aber doch ein Minus auf. Was die Jugendhilfe anbelangt, könnte sich das Rheinstädtchen bei den Angeboten für Eltern und deren Kinder auf die Pflichtaufgaben beschränken. Und doch baute Monheim in den zurückliegenden sechs Jahren sein präventives Netzwerk »Mo.Ki – Monheim für Kinder« auf und bezahlt die zuständige Koordinatorin. Dadurch bekommen heute Eltern und Kinder aus sozial benachteiligten Familien Bildungsangebote unterbreitet, die ihnen ohne diese Idee kaum zugänglich wären. Und natürlich spart die Stadt durch ihr mehrfach ausgezeichnetes Projekt zur Armutsprävention – langfristig.
Kita als Knotenpunkt im Hilfesystem
»Mo.Ki – Monheim für Kinder« startete nach der Jahrtausendwende. Damals schnellte die Zahl der schwierigen Jugendlichen in die Höhe, für die der Kämmerer der Stadt plötzlich die Heimkosten zu zahlen hatte. »Wir fragten uns, wieso wir spät so viel Geld ausgeben, um Jugendliche auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten und wie wir die gleiche Summe nutzen könnten, bereits Dreijährige zu unterstützen«, erinnert sich Annette Berg, die Jugendamtsleiterin von Monheim. Im Rückblick auf die Lebensgeschichte der Mädchen und Jungen bemerkte ihr Team, dass sich mit der Einschulung Schwierigkeiten in den Familien öffentlich zeigten, die in der frühen Kindheit entstanden und in der Pubertät eskalierten. Damals begann die Stadt die Kindergärten nicht nur in das Hilfesystem einzubinden, sondern sie als den Knotenpunkt im Kontakt zu den Familien zu betrachten. Dafür benannte das Jugendamt eine Koordinatorin, die sowohl mit den Kindergärten und den einzelnen Abteilungen der Jugendhilfe bestens vertraut war und zu den verschiedenen sozialen Trägern der Stadt die Fäden spinnen sollte – eine Aufgabe, die Inge Nowak seit sechs Jahren leistet. »Ich kümmere mich um all das, was heute eine Kita-Leiterin in den neu gegründeten Familienzentren zusätzlich schaffen sollte«, fasst die Sozialarbeiterin zusammen. Sie hat ihr kleines Büro in einer einstigen Abstellkammer der AWO-Kita in der Grünauer Straße, mitten im Berliner Viertel.
Sozial Benachteiligte werden früher gefördert
Denn Monheim hat ein Problem. Zu dem beschaulichen Städtchen am Mittelrhein gehört auch jenes in den 1960er und 1970er Jahren aus dem Boden gestampfte Neubaugebiet jenseits der Unterführung. Am Nachmittag spielen die Kinder auf den Spiel- und Sportplätzen, Eltern und Großeltern gehen mit den Kleineren spazieren. Vor den Markthallen trifft man sich zum Plausch. Sauber und friedlich präsentiert sich die Siedlung, in die etliches Geld aus Programmen wie dem der »Sozialen Stadt« floss. Dennoch beunruhigten die Stadtoberen die Sozialdaten aus dem Quartier, in dem ein Viertel der Einwohner Monheims lebt: Hier gibt es nur Sozialwohnungen, die sozial Schwache aus der Umgebung anziehen. Jeder zweite Monheimer nichtdeutscher Herkunft ist in den Plattenbauten zu Hause. Mehr als ein Drittel der Minderjährigen wohnt hier und 40 Prozent von ihnen müssen von Sozialhilfe leben und gelten als arm. »Gerade diese Kinder wollten wir früher fördern«, betont Annette Berg. Sie ist nicht traurig, dass die Zahlen für die Familienhilfe für Kinder unter sechs in den letzten Jahren stiegen. »Das wollte wir – und eben nicht die spätere Unterbringung jener Kinder im Heim.« Dabei hatte eine Analyse des Institutes für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. Frankfurt am Main bereits zum Start von Mo.Ki benannt, woran es auch in Monheims armen Familien fehlt: gesunde Ernährung, Sprach- und Beziehungsförderung sowie Bewegung. Dazu sollte das präventive Programm vor allem tätig werden.
Marte Meo heißt die Zauberformel
In der evangelischen Integrativen Kindertagesstätte in der Grunewaldstraße holt Christiane Berlemann ein Video aus dem Schrank, um zu zeigen, wie sich die Erzieherinnen dieser Aufgabe näherten. Marte Meo lautet in Monheim die Zauberformel: Wahrnehmen und das Gesehene positiv verstärken, kann die in den späten 1970er und den frühen 1980er Jahren von der Niederländerin Maria Aarts entwickelte Methode zur Familienberatung zusammengefasst werden. »Marte Meo« heißt aus dem Lateinischen übersetzt »mit eigener Kraft«. Im Film sitzt eine Erzieherin mit einem Dreijährigen vor einem Puzzle. Der zappelt mit den Armen wild umher, tippt mal hier und mal da hin. Diese Bewegungen verfolgt die Erzieherin ruhig und benennt, worauf der Junge zeigt. »Ja, da hast du einen Stern entdeckt.« Und das unruhige Kind, was vorher nicht sprechen wollte, wiederholt: »Stern!«. »Was wir tun: Wir verbinden die Handlung des Kindes mit Worten und zeigen ihm, worin es initiativ ist«, erklärt die ausgebildete Marte Meo-Therapeutin. »Gerade dadurch unterstützen wir es, seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten.« In dem drei Minuten langen Film weist der Junge auf das nächste Bild, schaut seine Erzieherin an und wartet, dass sie auch dieses Tun wahrnimmt, lächelt sie an, als sie seine Erwartung erfüllt und ihn nicht maßregelt. »Ich hatte ein Kind, das viel weinte und nur gestikulierte, als es in die Kita aufgenommen wurde. Nach einem dreiviertel Jahr äußerte er sich, wie es Vierjährige können«, spricht Erzieherin Bärbel Frischmuth begeistert über diesen Ansatz. Nachdem bereits seit 1997 die Familienhilfe mit diesem Prinzip der positiven Verstärkung zu arbeiten begann, wurden in den zurückliegenden Jahren fast alle Erzieherinnen zunächst im Berliner Viertel in dieser Methode fortgebildet. Dadurch veränderte sich nicht nur wesentlich die Beziehung zu den Kindern, sondern auch zu deren Eltern. Mit den Video-Sequenzen zeigen ihnen die Erzieherinnen, wie die Kinder auf noch so kleine Impulse warten, reagieren und gerade dadurch gefördert werden können. »Die Mutter des vierjährigen Jungen beispielsweise verstand, wie wichtig es ist, sich ihrem Sohn mitzuteilen, tut es heute und läuft nicht mehr einfach stumm neben ihm her«, freut sich die erfahrene Erzieherin. Sie weiß, auch sie musste sich dafür bewegen. Ihr Team war nicht frei davon, den Eltern mit erhobenem Zeigefinger zu begegnen. Sie erwähnt eine Mutter, die häufig ihr Kind zu spät abholt. Seitdem sie sich klar machte, dass es nicht deren böser Wille ist, geht sie entspannt auf die zerstreute Frau zu, fragt sie lächelnd: »Haben Sie sich in der Zeit vertan?« hört zu, ohne ihr aber später vorzuenthalten, in welche Nöte sie nun mit ihren eigenen Plänen kommt. »Ich merke, dass ich durch mein Entgegenkommen viel eher das Vertrauen der Eltern gewinne.«
Den vollständigen Beitrag können Sie in unserer Ausgabe Betrifft KINDER 05/08 lesen.