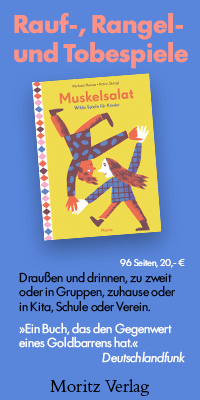|
Als ich ein kleines Mädchen war, noch an den Weihnachtsmann glaubte – und das tat ich sehr lange –, bekam ich von ihm ein wunderbares Geschenk. Meine ersten Skier und die dazugehörigen Stöcke, obwohl doch gar kein Schnee lag. Ich kann mich nicht erinnern, ob auch Skischuhe auf dem Gabentisch lagen. Halbschuhe mit fester Gummisohle reichten, um meine Rollschuhe daran festzuschrauben. Vielleicht klappte es bei der Skibindung auch. Nun wartete ich sehnsüchtig auf die Schneeflocken, damit ich im Grunewald von kleinen Hügeln und im Park von der Böschung sausen konnte.
Als es nach dem Fest weiß vom Himmel fiel, konnte ich mein Glück auf den Brettern endlich herausfordern. Meine Eltern hatten keine Zeit für die Fahrt zum Grunewald, und im Park störten die schnellen Schlitten mich bei meinen Slalomversuchen. Außerdem hatte kein anderes Kind in meinem Alter Skier, und ohne Gesellschaft blieb der Spaß aus. So kam es, dass ich in meinem Leben nie wirklich auf Skiern stand.
Der Schlitten kam wieder zu seinem Recht. Zwar war ich ein eher ängstliches Kind, doch ich stürzte mich in waghalsige Manöver: Ankoppelungen, Doppeldecker, Dreier, Rückwärtsfahrten und Bauchlagen. Meist trafen sich alle Kinder aus der Nachbarschaft im Park, der allerdings nicht gleich um die Ecke lag. Der Weg zur Rodelbahn, das Metallgeräusch der Schlittenkufen auf dem Pflaster, wenn der Schnee gefegt war, mit den Freundinnen schwatzen, die piekende, kalte Strippenschlaufe, an der ich den Schlitten zog, in handschuhfreien Händen und die Vorfreude auf das nachmittägliche Vergnügen – das war das Glück. Wir hatten kalte Füße, klamme Zehen, nasse Hosen, rote Hände und Wangen. Wir vergaßen den Hunger, das Heimgehen vor dem Dunkelwerden, die schmerzenden kleinen Wunden und Beulen…
Es gab viel Schnee in meiner Kindheit. Vielleicht blieb er in der Stadt länger liegen. In der langen Winterzeit war er der beste Spielbegleiter. Auf unberührten Schneeflächen im Park entdeckten wir nicht nur Spuren, sondern hinterließen auch welche. Am liebsten hatten wir die Schneeengel. Wir legten uns rücklings in den glatten Schnee und ruderten mit Armen und Beinen hin und her, so dass sich Flügel und Engelsgewänder bildeten. Dafür musste der Schnee frisch gefallen sein. Und er durfte nicht länger als drei Tage gelegen haben.
Wir kannten uns aus mit den Schneesorten. Neuschnee sieht anders aus als Schnee, der schon lange liegt. Die Eiskristalle sind noch fein verzweigt. Der Harsch später hört sich wie Zuckerkruste an. Es war lustig zu beobachten, dass unter seiner Kruste pulverartiger Schnee zum Vorschein kam. Manchmal war die harte Schicht ganz dick, und der Moment, in dem sie krachte, war aufregend. Gegessen haben wir den Schnee natürlich auch, unbeschadet.
Pappschnee fühlte sich anders an. Damit bauten wir Schneemänner, nach Vorbildern in alten Bilderbüchern. Feuchter Schnee klebte besonders gut. Die Bahnen, die entstanden, wenn wir große Schneekugeln rollten, erstreckten sich wie Strassen in einem Labyrinth und regten zu weiteren Spielen an.
Wenn wir mit einer Gießkanne Wasser über den Körper des Schneemanns sprühten, bekam er Stabilität. Wir dachten nicht darüber nach, warum das so ist. Der Schneemann lebte mit uns – je länger, desto besser. Eigentlich war er eine Art Wetterstation. Seine Veränderungen nahmen wir wahr, bis die Zeit des Abschieds kam und die ersten Schneeglöckchen seine kümmerlichen Reste begrüßten.
Heute weiß ich, dass die Figur des Schneemanns im 18. Jahrhundert populär wurde. In alten Bilderbüchern taucht er als personifizierter Winter mit grimmiger Miene und drohend erhobenem Besen auf. Der Winter war für die Menschen damals härter und entbehrungsreicher.
Trotz aller Schneemannfreuden fürchtete ich die Zeit des Pappschnees, weil die Jungen uns dann oft mit Schneebällen traktierten. Ich war immer auf der Flucht. So ein fester Schneeball tat weh, und die Jungen trafen ihr Ziel. Mit meiner Freundin wetteiferte ich, wer den Schneeball so fest an die Wand werfen kann, dass er haften bleibt. Das war gar nicht so einfach. Aber das Formen der Kugeln mit bloßen Händen war beliebt und für uns Mädchen viel wichtiger als ein treffsicherer Schuss: Erst ein kribbeliges Gefühl wie von Nadelstichen, dann gar kein Gefühl und dann ganz heiß – so war es.
Schnee hielt uns in Bewegung, dichtes Schneegestöber regte die Fantasie an. Schneeflocken tanzen, fallen, schaukeln, schweben, wirbeln, schmelzen und sind betörend schön. Keine gleicht der anderen. Sie sind klein oder groß, leicht, luftig, flockig oder schwer, trocken oder nass. Schnee glitzert, glänzt, kann bläulich, rosig, lila und unterschiedlich weiß aussehen. Schnee kann so schwer sein, dass er Dächer einstürzen lässt, Bäume und Hochspannungsmasten knickt.
Wie schwer ist Schnee? Erweitern wir die Wetterstation zur Messstation.
Dagmar Arzenbacher
Den vollständigen Beitrag können Sie in unserer Ausgabe Betrifft KINDER 12/08 lesen.