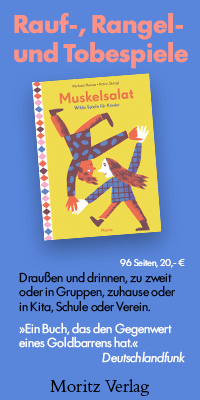|
Die Ergebnisse der PISA-Studie, die sich mit dem Leistungsstand von Kindern in der Mittelstufe aller Schularten befasste, wurden vor mehr als zehn Jahren veröffentlicht und lösten umfassende Debatten über den »Lernort Deutschland« aus. Auch die Kitas gerieten in das Blickfeld der Bildungsplaner und Kultusbehörden.
Als Reaktion auf die Ergebnisse der Studie wurde postuliert, dass Förderung in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik und Mathematik bereits in der früheren Kindheit notwendig sei, damit Kinder nicht nur besser vorbereitet und mit Interesse für den naturwissenschaftlichen Unterricht in die Schule kommen, sondern sich für naturwissenschaftlich und technisch orientierte Berufe qualifizieren möchten. Bis zum heutigen Tag gibt es jedoch keine wissenschaftliche Studie, die diese Schlussfolgerung als berechtigt legitimieren könnte.
Frühförderhysterie und Verwirrung
Die Frühförderprogramme verschiedener Einrichtungen – unter anderem das Haus der kleinen Forscher und das Science Lab – sowie Bildungspläne wie zum Beispiel der Hessische BEP förderten meiner Meinung nach inzwischen sogar eine Dichotomie zwischen Lernen und Spielen im Bewusstsein der Fachkräfte und der Elternschaft zu Tage. Zeit für das freie Spiel wurde zugunsten kognitiver Lernprogramme verkürzt. Dazu trugen auch die voreiligen Statements einiger Hirnforscher bei. Dabei zeigen alle wissenschaftlichen Befunde, dass kindliches Spiel und kognitive Entwicklung keine Gegensätze sind.
Die damalige Behauptung, nur in den ersten Lebensjahren seien im Gehirn Fenster zur Aufnahme von Wissen offen, führte zu einer Frühförderhysterie. Inzwischen wissen wir, dass dies nicht zutrifft. Auch Kategorien wie »hirngerechtes Lernen« oder »Neurodidaktik« sind ungenau und irreführend. Besondere Verwirrung verursachten der Begriff »Kind als Forscher« und die Kategorie »naturwissenschaftliches Denken im Frühalter«.
Experimente und der kindliche Forschergeist
Ein spezifisch naturwissenschaftliches Denken, dessen Vernetzungen im Gehirn nachweisbar sind, gibt es nicht. Es reicht nicht aus, Kinder und Jugendliche als »kleine Forscher« zu bezeichnen, sobald sie sich weiße Kittel anziehen, mit Geräten hantieren dürfen und dabei angeblich in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage ihrer Beobachtungen wissenschaftliche Theorien und Konzepte zu bilden.
Letzteres ist völlig auszuschließen, wenn man den Sinngehalt des Begriffs »Experiment« genauer betrachtet: Ein Experiment wird als wissenschaftliche Methode definiert, mit der eine Hypothese überprüft werden kann. Jedes Experiment wird unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, die der Forscher festlegt und bestimmte Parameter als nicht variabel, andere als variabel auswählt. Wie das experimentelle »Design« sich dabei verhält, wird ausgewertet.
Geht man von dieser allgemein gültigen Definition aus, reduziert sich die Leistungsfähigkeit der Experimente im Kindergarten auf bloße Bestätigungsversuche – und nicht mehr. Denn das Ergebnis aller Experimente steht von vornherein fest. Von Forschen kann deshalb keine Rede sein, und es zu unterstellen ist schlicht irreführend.
Es ist sogar zu befürchten, dass diese Art von Frühförderung, die den Vorgang von Trial und Error nahezu ausschließt, den Forschergeist der Kinder nachhaltig lähmt. Denn Kinder agieren als Forscher vollkommen anders als Erwachsene. Alle Kategorien, die einem Forschungsexperiment (siehe oben) zugrunde liegen, sind dem kindlichen Forschergeist fremd.
Bedenkt man, dass das jeweilige Experiment in der Regel nicht von einer Fragestellung und Hypothese der Kinder ausgeht und auch nicht von ihnen entworfen wurde, dann hat es auch keine Bedeutung für sie, weil es ihre Erfahrungsmöglichkeiten nicht integriert. Letztlich verkümmert jedes Geschehen, in das man sich nicht selbst kreativ einbringen kann, zur bloßen Unterhaltung und hinterlässt keine Spuren im Gehirn.
Vor diesem Hintergrund sind die Behauptungen, die Programme der Stiftung »Haus der kleinen Forscher« seien alltagsbezogen und das Angebot stelle das Experiment nur als Anregung zur Verfügung, nicht nachvollziehbar. Um das herauszufinden, muss man nur die Veröffentlichungen der Stiftung und ihre Selbstdarstellung im Internet lesen. Die akademische Sicht darauf, was unter Frühförderung zu verstehen sei, dominiert.
Lernen kann nicht stattfinden, wenn die Lehrenden oder Bezugspersonen ihre eigenen Vorstellungen und Konzepte auf die Kinder zu übertragen versuchen. Etwas in ein vorhandenes Schema zu pressen, das scheitert im-mer, eben weil es nicht passt. Vielmehr muss es darum gehen, vorhandene Schemata durch neue Erfahrungen zu modifizieren. Welche Aktivität oder welches Experiment der Stiftung kann dies leisten?
Den vollständigen Beitrag können Sie in unserer Ausgabe Betrifft KINDER 08-09/13 lesen.