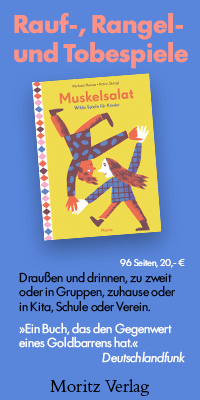|
Eine Erwiderung von Éva Hédervári-Heller und Annette Dreier auf Anna Winners Beitrag »Alles Bindung – oder was? Zu Risiken und Nebenwirkungen eines Modebegriffs«, erschienen in Heft 6-7/2013, S. 16-23
Sehr geehrte Frau Winner,
in Ihrem Beitrag kritisieren Sie die Unklarheit des Begriffs »Bindung«, der nach Ihrem Empfinden ein »Modebegriff« mit »Risiken und Nebenwirkungen« ist. Sie vermissen die wissenschaftlich eindeutige Definition von Bindung und schlagen deshalb vor, das Wort »Bindung« durch »Beziehung« zu ersetzen.
Da wir seit vielen Jahren als Bindungs- und Bildungsforscherinnen tätig sind, wollen wir uns nachfolgend mit einigen Ihrer Argumente befassen und aufzeigen, warum wir den Bindungsbegriff für die pädagogische Praxis und die Ausbildung pädagogischen Fachpersonals für unverzichtbar halten.
Seit wann sprechen wir über Bindung im Kontext öffentlicher Erziehung und Bildung?
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Bindungstheorie begann in der Bundesrepublik mit einer Beobachtung: Ein Forscherteam der FU Berlin beobachtete in den 1980er Jahren, dass Kleinstkinder, die in die Krippe kamen, wochenlang so sehr unter der Trennung von ihren Eltern litten, dass die Erzieherinnen sie kaum trösten konnten. Damals wurden neue Kleinstkinder stets zur gleichen Zeit aufgenommen. Deshalb war diese Zeit nicht nur für die Kinder eine seelische Qual. Auch Erzieherinnen und Eltern empfanden sie als »schreckliche Zeit«, durch die »man aber hindurch musste«, bis die Kinder sich schließlich zu beruhigen schienen.
Das Forscherteam der FU Berlin, später als INFANS bekannt1, war von der Beobachtung erschüttert und wollte sich mit der in Krippen üblichen Eingewöhnungspraxis nicht zufrieden geben. Also befasste es sich eingehender mit der von John Bowlby und Mary Ainsworth begründeten Bindungstheorie, um mehr über den Aufbau von Bindungen zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen und den Ablauf von Trennungen herauszufinden.2 Den Impuls für eine Forschungsinitiative, die Erzieherinnen und Eltern bessere Handlungsalternativen zum Wohle der Kinder anbieten wollte, gab also die unbefriedigende Praxis.
Die Bindungstheorie als theoretische Grundlage des Berliner Eingewöhnungsmodells
Das Berliner Eingewöhnungsmodell nach INFANS gründet sich wissenschaftlich auf die Arbeiten von John Bowlby, Mary Ainsworth und ihren Nachfolgern. Deren überwiegend in den 1960er und 1970er Jahren veröffentlichte Studien zeigen, dass Kinder ein Grundbedürfnis nach Nähe und Geborgenheit haben. Vom ersten Lebenstag an bauen sie in vielfältigen Interaktionen mit Erwachsenen enge emotionale Beziehungen auf. Da diese Beziehungen einen ganz besonderen Charakter haben und ein Leben lang für die Kinder bedeutsam bleiben, sprechen Bowlby und Ainsworth von Bindung.
Der Begriff steht für eine emotionale Beziehung, die über einen längeren Zeitraum anhält und besonders in Stresssituationen eine stützende Funktion für die Kinder hat. So eine Stresssituation ist zum Beispiel der Eintritt in eine Kita, der die stundenweise Trennung von den Eltern erfordert. Damit dieser Eintritt in eine neue Umwelt mit zunächst unbekannten Menschen und Tagesabläufen die Kinder möglichst wenig belastet, ist die Anwesenheit einer vertrauten Bindungsperson – meist Mutter oder Vater – sehr wichtig. Die Bindungsperson gibt den Kindern die emotionale Sicherheit, in der neuen Umgebung neue Bindungsbeziehungen aufbauen und die Umwelt erkunden zu können.
Da die Entwicklung neuer Bindungen jedoch Zeit braucht, ist die allmähliche Eingewöhnung der Kinder in Anwesenheit der Eltern nötig, bis eine emotional tragende Bindungsbeziehung zur Erzieherin entstanden ist, auf die sich die Kinder auch in Stresssituationen verlassen können. Aus diesem Grund wird im Berliner Eingewöhnungsmodell die schrittweise Eingewöhnung mit einem »Fahrplan« empfohlen: Eltern und Erzieherinnen erhalten Informationen über angemessenes Verhalten in der Eingewöhnungszeit und den Ablauf der ersten Trennung vom Kind. Besonders wichtig sind genaue Beobachtungen: Wie verhält sich das Kind? Wie nimmt es Kontakt zur zunächst noch fremden Erzieherin auf? Wie interagiert es mit ihr? Wie baut es eine Bindung zu ihr auf?
Wie kann der Bindungsaufbau beobachtet werden?
Die Bindungsforschung, die sich seit mehr als 60 Jahren mit der Entstehung und Entwicklung emotionaler Bindungsbeziehungen beschäftigt, liefert Erklärungsmodelle für die Entstehung und Entwicklung von Bindungsbeziehungen.3 Demnach existiert ein biologisch festgelegtes Bindungsverhaltenssystem, das das Überleben und die psychische Gesundheit des Kindes garantiert.
Dieses Bindungsverhaltenssystem ermöglicht es, Nähe und Kontakt zu vertrauten Bindungspersonen herzustellen und aufrecht zu erhalten: Das Kind schaut und lächelt diese Personen zum Beispiel an oder streckt seine Arme nach ihnen aus. Hauptsächlich in Stresssituationen oder bei inneren Belastungen – zum Beispiel bei Hunger, Müdigkeit oder Schmerz, in fremden Umgebungen, beim Zusammensein mit unbekannten Menschen oder in Trennungssituationen – wird das Bindungsverhaltenssystem des Kindes aktiviert. Aktiv sucht es die Nähe vertrauter Personen, Schutz und Sicherheit.
In solch emotional belastenden Situationen ist vor allem das junge Kind auf die Unterstützung der Bindungsperson angewiesen, denn sie ist emotional erreichbar und hilft ihm, seine Gefühle zu regulieren. Bindungsforscher bezeichnen diese Person als »sichere Basis«.4
Darüber hinaus erleichtert die Anwesenheit der Bindungsperson es dem Kind, zunehmend mehr Autonomie und Kompetenz zur Selbstregulierung seiner emotionalen Zustände und zur Erkundung seiner Umwelt zu erwerben. Es besteht nämlich eine Balance zwischen Bindungsverhalten und Erkundungs- oder Spielverhalten: Fühlt sich ein Kind emotional ausgeglichen, beschäftigt es sich intensiv mit der Exploration seiner Umgebung.
Verliert es sein inneres Gleichgewicht in einer Stresssituation, wird sein Bindungsverhaltenssystem aktiviert. Es hört auf zu spielen, sucht Nähe und Kontakt zu seiner Bindungsperson. Wie auf einer Wippe muss das Kind die Verhaltenssysteme Bindung und Erkundung ausbalancieren. Das kann es jedoch nicht allein. Es braucht ein Gegenüber, an das es sich binden kann. Als Gegenüber steuert die Bindungsperson die Bewegung der Wippe von außen mit und ist folglich aktiv am Bindungsaufbau beteiligt.
Der Erwachsene trägt mit seinem ebenfalls biologisch festgelegten Pflegeverhalten zum Aufbau der Bindung bei, indem er die Signale des Kindes wahrnimmt und angemessen beantwortet. Demzufolge bilden das Pflegeverhalten des Erwachsenen und das Bindungsverhalten des Kindes ein sich ergänzendes Verhaltenssystem.
In Eingewöhnungssituationen lässt sich das Bindungs- und Pflegeverhalten gut beobachten. In der neuen Umgebung mit unbekannten Menschen zeigen Kinder ihren Eltern gegenüber deutliches Bindungsverhalten. Wächst die Vertrautheit mit der Kita, orientieren sich Kinder mehr und mehr an ihrer Bezugserzieherin und richten ihr Bindungsverhalten auf sie aus: Sie interagieren oder spielen mit ihr und suchen ihre Nähe.
Damit zeigen sie, dass sie ihre Erzieherin als neue Bindungsperson annehmen, ohne dass die Eltern an Bedeutung verlieren. Im Gegenteil: Die Kinder machen die Erfahrung, dass mit Unterstützung der Eltern neue Bindungen entstehen können, die es ihnen ermöglichen, sich in einer zunächst fremden Umgebung mit zunächst fremden Erwachsenen zunehmend wohl zu fühlen.
1 Vgl. u. a. Laewen/Andres/Hedervari-Heller: Die ersten Tage – Ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflegestelle. Cornelsen, Berlin 2011
2 Vgl. Bowlby 1969, 1973, 1980; Ainsworth et al. 1978
3 Vgl. u. a. Bowlby 1969; Grossmann/Grossmann 2012; Ahnert 2010
4 Vgl. Ainswort et al. 1978
Den vollständigen Beitrag können Sie in unserer Ausgabe Betrifft KINDER 11-12/13 lesen.